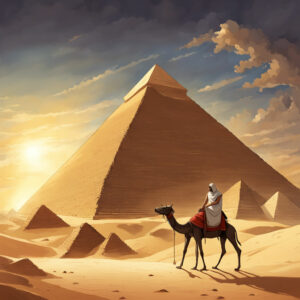
Das Verborgene in den Tiefen der Erde oder am Himmel besitzt eine starke magnetische Eigenschaft, die die menschliche Neugier weckt, die, ob gut oder schlecht, schon immer ein mächtiger Motor des Fortschritts war. Die Erwartung eines Wunders, das Streben nach Wahrheit und das Bedürfnis, ein weiteres Geheimnis zu lüften, liegen in der Natur des Menschen. Die Menschen suchen nach Schätzen, Spuren alter Zivilisationen und Botschaften von Außerirdischen. Sie graben, forschen, stellen Theorien auf, finden Antworten – oder auch nicht –, stellen neue Fragen und graben geduldig weiter.
Die alten Griechen zählten die Cheops-Pyramide zu einem der sieben Weltwunder, und seitdem ist der Weg zu ihr niemals erloschen – beginnend mit Eroberern, die sich über Jahrtausende in Scharen von Touristen verwandelten. Leider sind die sechs anderen Wunder der Antike nicht bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Die Hängenden Gärten der Semiramis, der Koloss von Rhodos und der Leuchtturm von Alexandria wurden durch Erdbeben zerstört; die Zeus-Statue in Olympia, der Artemis-Tempel in Ephesos und das Mausoleum von Halikarnassos fielen Bränden zum Opfer. Nur die Cheops-Pyramide, das älteste der Wunder, wurde von der Natur verschont.
Die Plätze der längst verlorenen Wunder haben andere menschliche Meisterwerke eingenommen – eine neue Liste der Weltwunder wurde 2007 verkündet, jedoch fand die Cheops-Pyramide darin keinen Platz. Dennoch faszinieren die Pyramiden weiterhin die Köpfe und die Fantasie der Menschen, während eine endlose Reihe von Bussen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang immer neue Gruppen von Touristen zum Gizeh-Plateau bringt.
Die Silhouetten der drei Pyramiden, die in einem flirrenden Cocktail aus Sonnenflimmern, Abgasen der Metropole und Wüstenstaub zittern, sind bereits von Kairo aus zu sehen. Wie ein Magnet zieht das Wunder den Blick an und ergreift das Bewusstsein. Doch der Blick ist neugierig, ihm ist alles interessant, und während er das Wunder gierig verschlingt, nimmt er ebenso bereitwillig das städtische Chaos auf.
Am Stadtrand zieht sich eine endlose Reihe moderner Slums hin – ein architektonisches Chaos, eine improvisierte Inszenierung des Konstruktivismus, angepasst an die lokalen Gegebenheiten. Fast alle Gebäude sind unvollendet – Kilometer um Kilometer gestapelter Ziegelkuben ohne Putz, mit leeren Fensteröffnungen. Manche haben es geschafft, Glas einzusetzen, andere haben die Öffnungen mit Stofffetzen verhängt, und wieder andere leben völlig offen zur Welt hin, die nackte Schwärze der Räume durch die unbedeckten Fensterrechtecke zur Schau stellend. Manchmal fehlen ganze Kuben an den Seiten oder in der Mitte der Gebäude, als wären sie herausgenommen oder versehentlich nicht eingesetzt worden, wodurch man das Innere der Behausung erkennen kann: ein mit Bauschutt bedecktes Treppenhaus, Kabel, Kisten…
Das Dach der ärmlichen Wohnungen bildet oft eine Betondecke mit aus ihr herausragenden, in alle Himmelsrichtungen gerichteten Bewehrungsstäben. Bringe Ziegel, baue deinen Kubus über den Kubus deines armen Nachbarn – so wird die Wohnungsfrage gelöst, zum Seelenfrieden derer, die ihre eigenen Lasten hinter hohen Mauern in ihre Villen tragen. Manchmal werden die dichten Reihen der Gebäude von einem mit Müllbergen übersäten Brachland unterbrochen, über das eine kleine Herde Schafe trottet. Die Spalten zwischen den Gebäuden bilden eine Art Straßen oder Korridore. Auf dem mit Müll bedeckten Boden in diesen Spalten laufen und gehen echte Menschen – homo sapiens lebt hier, und die Szene ist keine Phantasmagorie. Es ist, als ob der ewige Kampf zwischen Osiris und Seth, den alten ägyptischen Bruder-Göttern, der den Widerstreit von Ordnung und Chaos symbolisiert, auch hier mit wechselndem Erfolg weitergeht – wie eh und je, ohne Ende in Sicht.
In den Randbezirken von Kairo wird das Leben lebendiger, je näher man dem Stadtzentrum kommt. Die Linien werden geschwungener und krummer, eine Eigenheit, die sowohl der Natur – dem Werk Gottes – als auch der Unordnung der menschlichen Natur innewohnt, deren Wege selten gerade verlaufen. Gebäude mit eingestürzten Dächern und schiefen Wänden, asymmetrischen Fenstern, abblätternden Türen und offenen Garagen, vollgestopft mit Metallgerümpel, prägen das Bild. Schmutzige Lebensmittelläden wirken fast gemütlich. In der engen Kopfsteinpflasterstraße liegt ein gewisses eigenes Flair, und in den aufgestellten, halb kaputten Stühlen für müde Passanten scheint ein versteckter Sinn zu stecken.
Den ungeduldigen, hupenden Verkehrsstrom auf der Straße lenkt ein schwerfälliger Verkehrspolizist gemächlich – ein schlanker Beamter wäre in Ägypten undenkbar, das gilt als unsolide. Korpulenz ist ein Zeichen von Wohlstand und sozialem Status, während Magerkeit Armut und Zugehörigkeit zu den unteren Schichten signalisiert. Diese Regel gilt allerdings nicht für Frauen – sie werden alle runder. Ein dünner Mann, der hart arbeitet und wenig verdient, ist nichts wert. Ein dicker Mann hingegen hat wahrscheinlich eine gute Position, Wohlstand und ein Zuhause, in dem es genug zu essen gibt – und wahrscheinlich auch eine Frau, vielleicht sogar mehrere. Eine Frau ist ebenfalls ein Privileg. Ein Ägypter, der sich keinen Goldschmuck für die Braut leisten kann und keine komfortable Wohnung hat, hat es schwer, eine Familie zu gründen.
Je näher man dem Zentrum kommt, desto enger drängen sich die Gebäude aneinander. Das Chaos aus schmutzigen Wänden, Dächern, Fensteröffnungen, Balken und wackeligen, unzuverlässigen Treppen wird immer dichter. Die Menschenmengen nehmen zu, und der Puls der Stadt schlägt immer schneller. Über zwanzig Millionen Menschen atmen die Luft Kairos – 18 Millionen ständige Einwohner und mehr als 2 Millionen Pendler. Nur die Uferpromenade des Nils vermittelt ein Gefühl von Weite und etwas Frische. Doch die Weite ist rein optisch – ein breiter Fluss, entfernt liegende Gebäude an den Ufern. Das Wasser selbst, dunkel und undurchsichtig, wirkt bedrückend; es zu berühren, ist nicht angenehm. Es gibt Wasser, das man berühren möchte – dieses jedoch nicht. Nicht aus Angst, von einem Krokodil gebissen zu werden (diese Reptilien gibt es im Nil nur südlich des Assuan-Staudamms), sondern weil in diesem mächtigen, unruhigen Fluss etwas Bedrohliches liegt.
Der Nil, diese gewaltige afrikanische Lebensader, ernährt die gigantische Metropole an seinen Ufern, die nicht weniger beeindruckend ist als die großen Pyramiden. Apropos Krokodile… Plinius der Ältere, ein römischer Schriftsteller des 1. Jahrhunderts n. Chr., beschrieb in seiner „Naturgeschichte“ diese zahnbewehrten Reptilien, die er bei Memphis (am westlichen Nilufer, etwa 20 km südlich von Kairo) sah, als Wesen, die in mystischer Verbindung mit den Göttern stehen. Einmal im Jahr, an den Geburtstagen des heiligen Apis-Stiers, warfen die Ägypter goldene und silberne Schalen ins Wasser, an einem besonderen Ort. Bemerkenswerterweise griffen die Krokodile – von denen es sieben gab – während dieser Tage niemanden an. Erst am achten Tag kehrte ihre übliche Wildheit zurück. Vielleicht liegt die Erklärung eher in der Paarungszeit der Krokodile oder dem Zeitpunkt, zu dem die Weibchen ihre Eier ablegen. Doch lassen wir den Zauber Ägyptens unberührt und verzichten darauf, ihn mit derart prosaischen Überlegungen zu entzaubern.
Am Nil, dessen Ufer von Betonmauern gesäumt sind, fahren Motorboote, ausgelegt mit abgenutzten Teppichen, Touristen über den Fluss. Das Wasser spritzt über die Bordwände, der Flusswind zerrt erbarmungslos an den Haaren der verängstigten Reisenden, der Motor dröhnt heiser, und von der Promenade rufen und winken lautstark junge Einheimische. Mädchen in Kopftüchern senken ihre neugierigen Blicke, wenn sie den vorbeifahrenden Europäern begegnen. Wie eine Schar kleiner Affen jagen schreiende Kinder auf dem Beton den davonfahrenden Booten hinterher. Was erwartet diese Menschen? Werden sie im Labyrinth Kairos ihr Glück finden oder darin verloren gehen? Vielleicht schaffen sie es ans Meer, wo die fremde Zivilisation an Kraft gewinnt und Hoffnung auf ein besseres Leben mit Familie und Arbeit weckt?
Ägypten wird immer mehr mit Urlaub am Roten Meer assoziiert als mit Pyramiden. Das salzige Wasser mit seiner hohen Konzentration zieht wohlhabende Touristen aus Europa und sogar Übersee an. Ein kleiner Teil dieses Reichtums könnte auch den Einheimischen zugutekommen – vorausgesetzt, sie lernen Fremdsprachen und bauen Brücken des Verständnisses zu den Besuchern. Es hat sich herausgestellt, dass Ägypter ein erstaunliches Talent für Sprachen besitzen. Die mächtige und komplizierte russische Sprache lernen sie in nur vier Monaten – eine für Europäer unvorstellbar kurze Zeit. Und das nicht an Universitäten, sondern in kleinen Kursen, oft in schäbigen Hütten. Vielleicht liegt es an ihrem freien und aufnahmefähigen Geist, der einem Kind ähnelt, oder an ihrem verzweifelten Drang, der Armut zu entkommen, was die Gehirnzellen dazu antreibt, mit einer Intensität zu arbeiten, die in sogenannten entwickelten Gesellschaften selten anzutreffen ist.
Ein Künstler, der Kairo malen wollte, bräuchte wahrscheinlich nur vier Farben: eine Tube Braun, ein Drittel Grau, einen Tropfen Cadmiumgelb und etwas Weiß für die braun-grauen Schattierungen. Das genügt, um mit einem breiten Pinsel grobe Formen zu skizzieren – hohe Gebäude, Slums, den Fluss, staubbedeckte Blätter der wenigen Bäume und die Menschen in selbstgenähter Kleidung für Arme. Ihre konzentrierten, angestrengten Gesichter tragen die Spuren der täglichen Mühsal, die nötig ist, um den Lebensunterhalt zu sichern. Ein feinerer, weicherer Pinsel wäre geeignet, um die filigranen Details von Moscheen und Kirchen darzustellen. Die restlichen Farben des Spektrums beleben das Bild der Stadt durch die archäologische Schatzkammer des Ägyptischen Museums, das rosafarben leuchtet wie ein Flamingo, und den unglaublich bunten und vielfältigen Basar von Khan el-Khalili.
Es ist interessant zu erfahren, ob die Bewohner Kairos Wohnungen mit Blick auf die Pyramiden schätzen. Ebenso stellt sich die Frage, wie Pariser den Anblick des Hôtel des Invalides aus ihren Fenstern wahrnehmen, wie Londoner die Aussicht auf die Westminster Abbey oder Moskauer den Blick auf Lenins Mausoleum bewerten. Zurück nach Ägypten: Wie mag es wohl sein, jeden Tag das Werk einer unbekannten Macht vor Augen zu haben und sich immer wieder mit Fragen über deren Wesen und Natur auseinanderzusetzen?
Die heute offizielle Version, dass die Pyramiden von Gizeh als Gräber für die Pharaonen Cheops, Chephren und Mykerinos erbaut wurden, erscheint – selbst bei oberflächlicher Betrachtung alternativer Theorien – schwer glaubwürdig. Die perfekte und monumentale Form, die aus Steinblöcken von vielen Tausend Kilogramm, einige sogar mit einem Gewicht von mehreren Dutzend Tonnen, zusammengesetzt wurde, ruft Assoziationen nicht mit Pharaonen, sondern mit einer geheimnisvollen uralten Zivilisation, Außerirdischen oder göttlichen Wesen hervor. Die präzise an den Himmelsrichtungen ausgerichteten Seitenflächen lassen eher an eine Raumstation oder eine kosmische Relaisstation denken als an ein Grabmal. Die polierten Granitkästen, die als Sarkophage bezeichnet werden, wecken Gedanken an Zeitmaschinen oder himmlische Tore. Auch die Ägypter selbst verbinden die Pyramiden meist mit Gottheiten, die angeblich lange vor den Pharaonen über Ägypten herrschten. Den Bereich von Gizeh, wo die Pyramiden stehen, nennen sie das „Haus des Gottes Osiris“.
Die numerischen Fakten zu den großen Pyramiden bringen den Verstand zum Glühen: das Gewicht der gesamten Konstruktion, das Durchschnittsgewicht eines Blocks, die Gesamtzahl der Blöcke, die Neigungswinkel der Seitenflächen, die Jahre, die benötigt wurden, um die Blöcke herzustellen, die Bauzeit der Pyramide aus den vorgefertigten Blöcken, die Anzahl der an der Errichtung beteiligten Menschen und die Entfernung, aus der der Granit herangeschafft wurde…
Die frühesten Berichte über die Pyramiden stammen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. und finden sich bei Herodot. Dank ihm, dem Denker, Reisenden und „Vater der Geschichte“, kennen wir die Namen der Bauherren der Pyramiden von Gizeh – die Pharaonen der 4. Dynastie: Chufu, Chafra und Menkaura (in griechischen Versionen: Cheops, Chephren und Mykerinos). Laut Herodot dauerte der Bau der Cheops-Pyramide, der mit enormen Schwierigkeiten für ganz Ägypten verbunden war, 20 Jahre. Das ist im Grunde die gesamte uns aus schriftlichen Quellen bekannte Information. Bereits antike Autoren stellten jedoch einige Angaben Herodots infrage, und moderne Historiker weisen darauf hin, dass er bei der Beschreibung der Pharaonen einige Fehler gemacht habe. Daher betrachten sie seine Berichte über die Pyramiden mit einer gewissen Skepsis.
Ernsthafte Forschungen in Ägypten werden seit der Zeit Napoleons durchgeführt. Folianten wurden beschrieben, Dutzende von Schwänen und Gänsen mussten ihre Federn geben, und mehr als ein Lineal ist abgenutzt worden – doch der Wahrheit ist man nicht nähergekommen: Wer hat die Pyramiden gebaut, wie und zu welchem Zweck? In Ägypten gibt es mehr als hundert Pyramiden: hohe und niedrige, gut erhaltene und durch die Zeit oder Menschenhand fast zerstörte. Die meisten ägyptischen Pyramiden bestehen aus einfachen, grob behauenen Steinen, die mit Lehmmörtel verbunden sind – sie wurden also mit Mitteln und Methoden gebaut, die den alten Ägyptern lange vor unserer Zeitrechnung zur Verfügung standen.
Doch es gibt sieben Ausnahmen – sieben Pyramiden, darunter die drei berühmten „großen“ Pyramiden der Nekropole von Gizeh. Diese Bauwerke aus gigantischen Steinblöcken, die mit einer Präzision von Millimetern aufeinander abgestimmt sind, scheinen nicht in das technische Niveau der damaligen Gesellschaft zu passen. Ägypten war zwar im Vergleich zu anderen damals von Menschen besiedelten Gebieten hoch entwickelt, doch nach den Maßstäben des 21. Jahrhunderts war es immer noch eine primitive Zivilisation. Es ist paradox, dass die Menschheit im Laufe von Jahrtausenden des Fortschritts Fähigkeiten verloren hat, die die Vorstellungskraft beflügeln. Wer besaß dieses Wissen? Wird es je gelingen, das Geheimnis der Technologien vorantiker Zeiten zu entschlüsseln? Und wenn ja, wann?
Vielleicht können die Tarotkarten, die laut Legende ähnlich wie die Pyramiden ebenfalls ein Produkt der alten ägyptischen Kultur sind, etwas Licht in diese Frage bringen? Über das Geheimnis der mysteriösen Tarotkarten wurde viel spekuliert! Der berühmte Milorad Pavić hat ihnen sogar einen Roman gewidmet – Die letzte Liebe in Konstantinopel, ein Tarot-Roman –, doch „der Karren steht immer noch an derselben Stelle“. Die Karten wollen genauso wenig wie die Pyramiden den Status Ägyptens als geheimnisvollste Zivilisation der Erde herabsetzen.
Cairo verliert durch seine Nähe zu den großen Pyramiden auf dem Giza-Plateau. Cairo, in der Farbe des Sandes, wahrt die Harmonie der Farben, verletzt jedoch die Harmonie der Formen. Der Surrealismus der Landschaft wird zerstört von Kameltreibern, Souvenirverkäufern und der unglaublich energischen und lauten Menge. Ihr Lärm schneidet die Stille, die über dem Plateau schwebt, und ihre Geschäftigkeit verunsichert die Magie des Ortes. Und wie lästige Insekten möchte man sie vertreiben. Vertreibst du sie, wird dir die Schärfe und Unbeherrschtheit unangenehm. Und du wirst einem Menschen, der durch Armut zur Demütigung verurteilt ist, einen Dollar geben. Eine dürre, schmutzige Hand wird die Almosen verbergen, und auf dem groben Gesicht wird ein Grinsen von riesigen, furchterregenden Zähnen erscheinen – eine Ähnlichkeit mit einem Lächeln. Wo sind die schönen Gesichter, die die alten Ägypter malten? Haben sie die Araber verschlungen, die Armut oder haben sie diejenigen, die die Pyramiden bauten, mitgenommen? Oder wurden sie von den „zehn ägyptischen Plagen“ zerstört, die dem Exodus der Juden vorausgingen? Manchmal flackert kurz ein schönes, nicht durch Armut, Klima oder unerträgliche Arbeit entstelltes Gesicht eines Vertreters einer anderen Welt auf und verschwindet in der Masse ewiger Armut und Unwissenheit.
Die Stadt, die sich den Pyramiden nähert, wird ebenfalls Giza genannt – ein unscheinbarer, schmutziger Ort, der eher einem der vermüllten Bezirke von Kairo als einer eigenständigen Siedlung ähnelt. Zwischen Kairo und Giza gibt es jedoch keine sichtbare Grenze. Vielleicht begegnet man in Giza häufiger Eseln, Schafen und Kamelen; in den niedrigen, unscheinbaren Gebäuden haben sich mit Gold und neuen Teppichen verzierte Fabriken für Öle und Papyrus niedergelassen – in Wirklichkeit handelt es sich um Handelsläden, die ihre Produkte gegen den hochgeschätzten Dollar, den kaum verwendbaren Euro und sogar den russischen Rubel tauschen. Aber Touristen sind nicht immer naiv, und unter ihnen gibt es viele Schlaue. Sie trinken Karkadeh auf Kosten des Ladens, hören eine kurze, wenig überzeugende Vorlesung über wundersame Öle und zahlen nur mit einem Lächeln für die Gastfreundschaft. Machen die Besitzer der „Fabriken“ einen Fehler, wenn sie ihre Warenwerbung slawisch sprechenden Mitarbeiterinnen anvertrauen, die die Sprachen beherrschen, aber nicht die Gabe der Überzeugungskraft besitzen? Jeder Araber an der Küste, der gerade begonnen hat, die Grundlagen der weiten russischen Sprache zu lernen, wird viel mehr verkaufen, indem er mit seinen verführerischen, mandelförmigen Augen und langen Wimpern hypnotisiert und mit einer charmanten, sanft überzeugenden Stimme spricht – wie sie die betörende Kleopatra hatte. Und die Hand öffnet sich von selbst, gehorchend den überzeugenden Worten, und legt eine beträchtliche Summe für Fläschchen mit östlichen Mischungen und Aromalampen aus.
Um alles zu bekommen, wovon man träumt, wie die einheimischen Reiseführer behaupten, muss man nur ein Cartouche kaufen, und die Cartouches werden neben den „Fabriken“ für Öle und Papyrus verkauft. Ein ovales Amulett mit schön in es eingraviertem Namen des Besitzers und geheimen Symbolen verspricht Glück und Wohlstand. Cartouches wurden von ägyptischen Pharaonen getragen, und heute kann jeder die Segnungen des Pharaos erlangen – man muss nur das Cartouche tragen. Der Verkäufer möchte das geheime Symbol mit dem Reisenden teilen – natürlich nicht kostenlos, sondern gegen Bezahlung. Auch um seinen Hals hängt ein goldenes Oval, und in seinen Augen springen Zahlen – aber nicht aus Gier, sondern aus Armut. Nein, danke, ich glaube nicht an ägyptisches Glück, mir ist ein christliches Amulett lieber. Aber das Fläschchen mit Lotus-, Eukalyptus- oder orientalischen Mischöl nehme ich – man kann den verführerischen Augen nicht widerstehen. Ich werde die Lampe an einem langen Winterabend anzünden und, während ich den fernen südlichen Duft einatme, der die Eigenschaft hat, Halluzinationen des Dunstes um Kairo, des Sandes und des Meeres hervorzurufen, den Rest des Abends in Tagträumen über das ferne heiße Land verbringen.